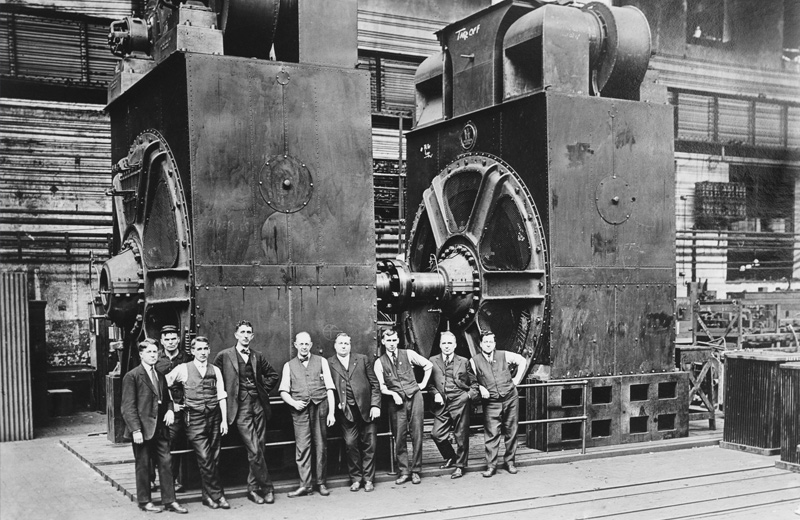Gottfried Heller gilt als einer der besten Kenner der internationalen Finanzmärkte. 1971 gründete er zusammen mit der Börsenlegende André Kostolany die Vermögensverwaltungsgesellschaft FIDUKA. Sein Buch „Der einfache Weg zum Wohlstand“ ist gerade in vierter Auflage erschienen. Weil er sich Sorgen macht, dass die Deutschen mit ihrem ängstlichen Sparverhalten ihre Zukunft verspielen, hat er gerade die Website www.gottfried-heller.de eingerichtet, auf der er als unabhängiger Experte Aufklärungsarbeit in Sachen Geldanlage leistet.
MBVO: Herr Heller, der DAX eilt von Rekord zu Rekord. Viele Privatanleger haben die Hausse verpasst und fragen sich, ob sie beim jetzigen Kursniveau noch einsteigen sollen. Manche haben gar Angst vor einem Crash. Was raten Sie den Anlegern?
Gottfried Heller: Ich wundere mich und finde es eine Sprachverrohung, dass man bei dem, was man früher eine Korrektur nannte, heute von Crash spricht. Wenn eine Übertreibung stattgefunden hat und daraufhin ein Kurs-Rücksetzer um zehn Prozent kommt, ist das noch lange kein Crash. Das steht ganz im Einklang mit dem, was mein Freund Kostolany mit dem Beispiel des „Mannes mit Hund“ gesagt hat. Der Mann, der die Wirtschaft symbolisiert, geht voran, mal langsamer, mal schneller. Der Hund, er symbolisiert die Börse, rennt mal voraus, bleibt mal hinten, kommt aber immer wieder zu dem Mann zurück. Ich denke, dass jetzt schon mal eine Korrektur kommen wird, um vielleicht fünf oder zehn Prozent. Man muss aber nicht unbedingt darauf warten, um an der Börse einzusteigen.
Was könnte der Auslöser für eine Korrektur sein?
Die US-Börsen haben sich vergangenes Jahr besser entwickelt als der DAX und tendieren im bisherigen Jahresverlauf seitwärts. Insofern beruht der fulminante Anstieg der Börsen in Europa in den ersten Monaten 2015 zum Teil auch auf einem Nachholeffekt. Ich kann mir vorstellen, dass in den USA in nächster Zeit eine leichte Korrektur einsetzt, die wegen der Leitfunktion der Wall Street auch auf Europa ausstrahlt.
Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach das Liquiditätsargument, das von Aktienstrategen so gerne bemüht wird?
Die amerikanische Notenbank Fed hat im vergangenen Oktober ihr Quantitative-Easing-Programm beendet, während die Europäische Zentralbank ihres in Europa gerade erst begonnen hat. Schon die Ankündigung der Anleihekäufe durch die EZB hat an der Börse zu steigenden Kursen geführt. Zwar erhöht die Fed die Liquidität nicht weiter, aber in die Lücke springt nun die EZB mit 60 Milliarden Euro pro Monat. Zudem hält Japans Notenbank die Geldschleusen weit geöffnet, und die Bank von China hat die Zinsen gesenkt. Das heißt: Global nimmt die Liquiditätsschwemme an Intensität noch zu, wenn auch regional unterschiedlich. In den Regionen, in denen sie zunimmt, ist ein unmittelbarer Effekt an der Börse sichtbar.
Ist also trotz sechs Jahren Hausse ein Ende des Aufwärtstrends an den Aktienmärkten nicht in Sicht?
Dafür sprechen neben der Geldschwemme und Quasi-Nullzinsen weitere Argumente. So stellt die Halbierung des Ölpreises ein Welt-Konjunkturprogramm dar, und speziell für Europa kommt die Abwertung des Euro um rund 22 Prozent hinzu. Was Italien früher mit Abwertungen für die Lira praktizierte, macht nun der Italiener Mario Draghi als EZB-Präsident summarisch für die ganze Eurozone.
Der Kursanstieg an den Aktienmärkten hat sich bei einer bemerkenswert geringen Volatilität vollzogen. Wird das so weitergehen oder müssen wir künftig mit stärker schwankenden Notierungen rechnen?
Es ist in der Tat erstaunlich, wie schwankungsarm sich der Kursaufschwung vollzog. Bei dem mittlerweile erreichten Niveau könnten die Schwankungen etwas ausgeprägter werden. Allerdings stellt die Liquidität eben auch eine Unterfütterung der Hausse dar – was für eine gewisse Absicherung der Kurse nach unten spricht. Hinzu kommt die Bewertung, die gemessen am KGV noch immer moderat ist. Es liegt auf Basis der geschätzten Unternehmensgewinne für 2016 bei 12,6 beim DAX. Am Höhepunkt der New-Economy-Blase im Jahr 2000 lag es bei 33. Damals war ein Crash vorgezeichnet, heute nicht. Vielmehr haben wir heute vier Treiber für die Aktienkurse: Liquidität, Anlagenotstand wegen der extrem tiefen Zinsen, der niedrige Ölpreis, die Euro-Abwertung.
Bedeutet das, dass das künftige Wachstum der Unternehmensgewinne die erreichten Bewertungen an den Aktienmärkten rechtfertigt?
Ja, deshalb kann auch keine Rede von einer Blase am Aktienmarkt sein. Aber man muss Anleger, die jetzt einsteigen wollen, davor warnen, jeden Tag die Kurse anzusehen. Sie sollten einfach davon ausgehen, dass die Börse noch ein, zwei Jahre läuft, es aber immer wieder Dellen geben wird.
Aber am Anleihemarkt kann man wahrscheinlich von einer Blase sprechen, wenn man bedenkt, dass wir bei Bundesanleihen bis in den Sieben-Jahres-Bereich hinein negative Renditen haben. Nun kommen die Anleihekäufe der EZB hinzu. Wohin soll das Ganze noch führen?
Das EZB-Programm, für 1,1 Billionen Euro Anleihen zu erwerben, davon 80 Prozent Staatsanleihen, ist kaum umzusetzen, ohne Schrottanleihen zu kaufen. Wenn die EZB Staatsanleihen gemäß der Gewichte der Euro-Mitgliedsländer kauft, geht es immer weiter in den negativen Bereich. Dann muss man Finanzminister Schäuble noch mehr Geld zahlen, wenn man eine Bundesanleihe kauft.
Wird demzufolge der Anlagenotstand noch größer?
Das ist richtig. Ich würde sagen, dass die Geldschwemme, die Mario Draghi liefert, ein Rettungsprogramm für die kränkelnden Euro-Südländer ist. An erster Stelle für sein eigenes Land, Italien, das sich Reformen störrisch verweigert. Es hat letzten Endes nur den Sinn, den Euro abzuwerten.
Kann man das EZB-Programm nicht mit dem QE der US-Notenbank Fed vergleichen?
Nein, denn die quantitative Lockerung in Amerika erfolgte bei einem Zinsniveau von rund 4,5 Prozent bei den 30-jährigen Bonds. Die Idee dahinter war, den Anleihezins auf zwei oder drei Prozent zu drücken und damit auch den daran gekoppelten Hypothekenzins entsprechend zu senken. Damit erreichte die Fed, dass viele Hausbesitzer, bei denen die Finanzierung auf der Kippe stand, ihre Immobilie behalten konnten – und Amerikaner, für die bei sechs, sieben Prozent Hypothekenzins kein Wohneigentum in Frage kam, es sich bei drei bis vier Prozent leisten konnten. Damit hat die Fed den Immobilienmarkt stabilisiert. Inzwischen sind die Häuserpreise von ihrem Tiefpunkt aus wieder um 25 bis 30 Prozent gestiegen. Zusammen mit den steigenden Aktienkursen hat das zu einem Wohlstandseffekt geführt, der auch dazu beigetragen hat, den Konsum ins Laufen zu bringen. Die Menschen fühlen sich reicher und gehen wieder shoppen. In der Folge sprangen dann auch die Investitionen an. Die Fed hat also einen klassischen Konjunkturzyklus entfacht.
Was entfacht die EZB?
Heller: Draghi entfacht nichts anderes als eine Euro. Es gibt keinen Zinssenkungsspielraum mehr, die EZB wird keinen Cent zusätzliche Kreditvergabe auslösen. Es geht ausschließlich um die Abwertung des Euro.
Beschwört Draghi damit nicht eine Art Währungskrieg herauf?
Zumindest beschreitet er einen Pfad, der irgendwann den Widerstand anderer Währungsräume herausfordern wird. Die Amerikaner können eine Weile zusehen, zumal sie beim Öl inzwischen Selbstversorger sind, was die US-Handelsbilanz enorm entlastet. Aber wenn sich ihre Konjunktur einmal abschwächt und es hart auf hart kommt, werden sie reagieren. Bekanntlich neigen Wechselkurse zum Überschießen, weshalb ich mir vorstellen kann, dass der Euro bald bei 1,0 Dollar steht. Dann hätte er um rund 30 Prozent abgewertet.
Was würde das für Deutschland bedeuten?
Deutschland braucht diese Abwertung nicht und wird auf lange Sicht in doppelter Hinsicht benachteiligt. Erstens werden wir Inflation importieren. Draghi will wegen der Südländer mehr Inflation, damit sie ihre hohen Schulden leichter bedienen können. Zweitens: Für die deutsche Wirtschaft entfällt der Zwang, immer wieder zu rationalisieren und sich wettbewerbsfähig zu halten. Wir hatten zu D-Mark-Zeiten 17 Aufwertungen. Man kann nicht behaupten, dass unser Export deshalb zusammengebrochen wäre. Außerdem ist es ein Märchen, wenn von manchen behauptet wird, Deutschlands Währung würde um 50 Prozent aufwerten, wenn wir aus dem Euro austräten. Wenn der Export tatsächlich einbräche, würde der Wechselkurs wieder in die andere Richtung reagieren und es bliebe nicht bei der starken Aufwertung.
Die Defizitländer der Eurozone stellen Deutschland wegen seines hohen Exportüberschusses gerne an den Pranger. Erhöht eine anhaltende Euro-Abwertung in dieser Hinsicht das Konfliktpotential in der Eurozone nicht weiter?
Natürlich, Deutschland mit seiner hohen Exportquote erhält sozusagen ein ungewohntes Geschenk und wird dafür auch noch von den anderen Eurostaaten wegen seiner Exportüberschüsse attackiert. Und langfristig werden wir durch Inflation bestraft.
Aber im Moment sieht es nicht nach Inflation aus. Wo soll die künftig herkommen?
Nach der Weltwirtschaftskrise 1929 war Geld an Gold gekoppelt und es gab eine Geldebbe. Im heutigen reinen Papiergeldsystem gibt es diese Bindung nicht mehr und wir haben eine Geldflut. Damals gab es Deflation, heute werden wir Inflation bekommen. Sie kommt nicht im Schneckentempo, sondern eher wie ein Tausendfüßler, der gerade Winterschlaf hält, irgendwann jedoch aufwacht und mit tausend Füßen losrast. Manche Volkswirte behaupten, mit der Inflation verhält es sich wie mit einer Ketchupflasche. Erst kommt lange nichts, dann aber plötzlich alles auf einmal. Das kann insbesondere dann passieren, wenn die Wirtschaft in den wichtigen Weltregionen wieder einigermaßen synchron wächst. Dann werden mehr Öl und andere Rohstoffe benötigt, so dass die Inflation über die Kostenseite angestoßen wird. Solche Inflationen sind in der Regel schwieriger zu bekämpfen als von der Nachfrage getriebene. In der Folge rufen die Gewerkschaften nach Lohnerhöhungen, um Kaufkraftverluste auszugleichen – und beschleunigen den Preisauftrieb.
Also muss sich die EZB gar nicht um Deflation sorgen, wie Draghi und Co. immer behaupten?
Richtig! Es ist Schwachsinn, zu behaupten, die Inflation sei tot und wir müssten Deflation bekämpfen. In der Weltwirtschaftskrise fielen die Preise um 25 Prozent. Wenn die Verbraucherpreise heute mal um ein Prozent zurückgehen, hat das nichts mit Deflation zu tun. Deshalb kaufen die Verbraucher kein bisschen weniger als vorher. Wegen einem Prozent Rückgang beim Lebenshaltungskostenindex verschiebt niemand den Kauf eines Autos. Hinzu kommt: Der disinflatorische Effekt, der auf die kostengünstige Produktion in den Schwellenländern zurückzuführen ist, läuft mehr und mehr aus. In China und anderen Schwellenländern sind die Löhne um 30 Prozent und mehr gestiegen. Wir können nicht auf Dauer zu Niedrigstpreisen Waren aus den Emerging Markets importieren.
Ein anderes Thema, das die Anleger länger beschäftigt als ihnen lieb ist, ist Griechenland. Wie geht es damit weiter?
Mittlerweile verwenden manche Beobachter statt dem Wort „Grexit“ den Ausdruck „Graccident“. Damit wird angedeutet, dass das unbotmäßige und irrationale Verhalten der griechischen Regierung dazu führen könnte, dass Griechenland unabsichtlich aus dem Euro ausscheidet. Die dortige Links-Rechts-Regierung hat es sich nicht nur mit den Kern-Eurostaaten verdorben, sondern auch Spanien und Portugal verärgert, indem sie behauptete, diese hätten daran gearbeitet, die Griechen aus dem Euro zu treiben. Auf Grund ihrer Wahlversprechen müssen Tsipras und Varoufakis zuhause rhetorische Klimmzüge machen, um dem griechischen Volk zu sagen, dass sie in Brüssel nicht klein beigegeben haben und dass andererseits die Geduld und Solidarität der Geberländer allmählich schwindet. Das Vertrauen ist längst zerstört und die Solidaritätsneigung wird immer geringer. Das konfliktträchtige Verhalten des Schuldnerlandes im konsensgesteuerten Europa könnte den „Unfall“ eines griechischen Euro-Austritts nach sich ziehen.
Was wäre denn eine sinnvolle Lösung für die Griechen?
Sie könnten zusätzlich zum Euro eine Parallelwährung, zum Beispiel eine abgewertete Drachme – einführen und wahlweise verwenden. So könnten sie ihren Sozialstaat finanzieren und gleichzeitig Währungsreserven in Euro aufbauen. Andere Länder, zum Beispiel Südafrika in den 1980er-Jahren mit dem Finanz- und dem Handelsrand, haben vorgemacht, wie so etwas funktionieren kann. Eine andere Alternative hat ifo-Chef Hans-Werner Sinn vorgeschlagen, nämlich dass Griechenland für eine gewisse Zeit aus der Eurozone ausscheidet, seine Wettbewerbsfähigkeit wieder herstellt und leistungsfähige staatlichen Strukturen aufbaut, um dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Währungsunion einzutreten.
Was würde das für die Eurozone bedeuten?
Das wäre für Länder wie Italien und Frankreich ein heilsamer Schock. Sie würden feststellen, dass eine Währungsunion auf Dauer nur funktionieren kann, wenn einheitliche Regeln gelten und Disziplin herrscht. Wer ständig gegen die Regeln verstößt, der muss eben die Währungsunion verlassen. Es ist auch Unsinn, zu behaupten, dass ein Grexit ähnliche Folgen hätte wie die Lehman-Pleite. Lehman hatte vier Billionen Dollar ausstehende Derivate, die über die ganze Welt verteilt waren. Der Virus war sozusagen global im System, fast jede Bank war in irgendeiner Weise infiziert. Davon kann bei Griechenland keine Rede sein.
Die Ukraine-Russland-Krise ist ein weiteres Thema, das immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Aber an der Börse scheint es im Moment keine große Rolle mehr zu spielen. Muss man künftig trotzdem wieder mit negativen Auswirkungen auf die Aktienmärkte rechnen?
Nein, das ist für die Börse ein Nebenkriegsschauplatz. Russland ist als Handelspartner relativ unbedeutend, es verfügt über Rohstoffe, vor allem Öl und Gas. Aus diesem Bereich generiert das Land die Hälfte seiner Staatseinnahmen. Putin spielt ein gefährliches Spiel, das er auf Dauer nicht gewinnen kann. Je länger das Spiel dauert, desto wahrscheinlicher wird seine Niederlage. Die Inflationsrate liegt inzwischen bei 15 Prozent, Trend weiter steigend. Der Ölpreis hat sich halbiert, Russlands Einnahmen brechen weg. Die Frage ist, wie lange das russische Volk Putin noch unterstützen wird. Die Sanktionen des Westens zeigen durchaus Wirkung.
Manche Anleger befürchten, dass die US-Notenbank Fed die Börsenparty stören wird, indem sie bald die Zinsschraube anzieht. Sind sie berechtigt?
Das Vorgehen der Fed hängt ganz davon ab, was der Rest der Welt macht. Japans Wirtschaft lahmt, die Abenomics haben bisher nicht so gewirkt wie erhofft. China hat große Probleme mit hochverschuldeten Kommunen und seine Wachstumsprognose für 2015 gerade nach unten revidiert. Japan und China haben wiederum eine große Bedeutung für ganz Asien. Brasilien als großer Rohstoffproduzent leidet unter gesunkenen Rohstoffpreisen und die Konjunktur in der Eurozone dümpelt vor sich hin. Hier finden keine Reformen statt, weil die Regierungen die Zeit nicht nutzen, die die EZB ihnen kauft. Damit kann ein Szenario eintreten, bei dem Fed-Chefin Janet Yellen sagt, dass man sich angesichts der globalen Wachstumsschwäche mit Zinserhöhungen noch Zeit lassen kann. Das heißt: Die EZB wird am längsten damit warten, den Leitzins anzuheben. Aber auch die Fed wird zögerlich vorgehen und frühestens Mitte 2015, wahrscheinlich sogar erst später erhöhen – und das in Trippelschritten. Sie wird dabei auf Sicht fahren, also jeden kleinen Zinsschritt von der jeweiligen wirtschaftlichen Situation abhängig machen.
Was heißt das für die Aktienmärkte?
Ich glaube nicht, dass die Zinsproblematik für die Börse gefährlich wird. Denn die Fed will vermeiden, dass die Bondblase mit einem Knall platzt, sondern sie vorsichtig anstechen, damit die Luft langsam entweicht. Ein ruckartiger Anstieg um mehrere Prozentpunkte ist wegen der schwachen Weltkonjunktur nicht erwünscht und auch nicht nötig. Von daher sehe ich keine Gefahr für die Aktienmärkte. Korrektur ja, aber keine Trendwende.
Herr Heller, vielen Dank für das Gespräch.