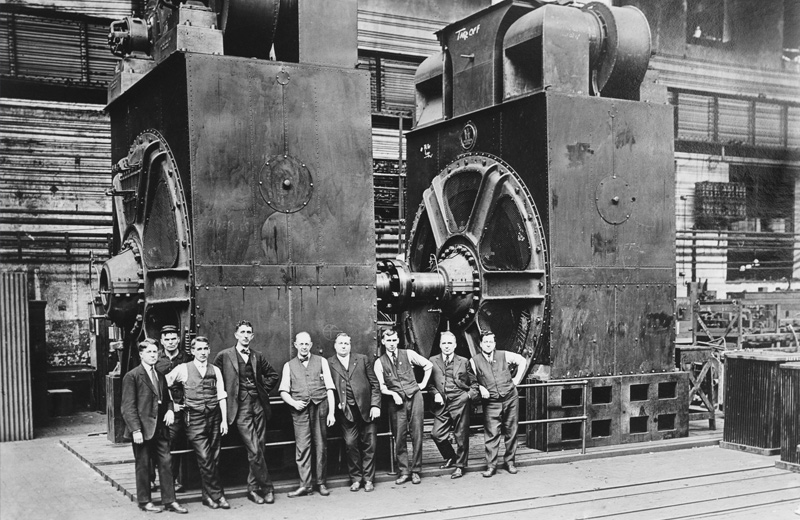Der Börsencrash in China verunsichert die Anleger. Schlägt der Kurssturz auf die Realwirtschaft durch? Fragen an den renommierten Vermögensverwalter und Buchautor Gottfried Heller. Gottfried Heller: „In konjunkturell starken Ländern wie Deutschland rechne ich mit einer Inflationsrate von 3 % und mehr.“
VDI nachrichten: Herr Heller, die chinesischen Börsen sind abgestürzt und haben dem Dax zugesetzt. Wie gefährlich ist die Entwicklung?
Heller: Der Kurssturz ist teilweise technischer Natur und noch eine Folge der Börsenblase von 2015. Es waren hauptsächlich völlig unerfahrene Kleinanleger, die die Kurse damals in die Höhe trieben – viele von ihnen, indem sie auf Kredit spekulierten. Bei den massiven Verkäufen im vorigen Sommer und jetzt wieder handelt es sich zum Teil um Zwangsexekutionen der Kredit gebenden Banken.
War es richtig, den Börsenhandel vorübergehend auszusetzen?
Nein, der Ausverkauf wurde verschlimmert, weil die Börsenaufsicht den Handel nach einem Verlust von 7% zweimal aussetzte. Das hat ausländische Fonds zu massiven Verkäufen veranlasst, aus Furcht, dass sie nicht mehr aus ihren Investments rauskommen. Der Dax und alle anderen Weltbörsen wurden in Mitleidenschaft gezogen, weil die chinesische Börsenschwäche als ein Indiz für eine stärkere Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft gewertet wird. Dies vor allem auch, weil die chinesische Zentralbank den Yuan innerhalb weniger Tage um knapp 2% abwertete.
Die chinesische Führung will dem Dienstleistungs- und Konsumsektor stärken. Beide Sektoren entwickeln sich positiv. Warum starren die Börsianer vor allem auf die etwas schwächeren Zahlen des Industriesektors?
Der Wandel der chinesischen Wirtschaft hat Auswirkungen auf die Rohstoffländer und die Exportländer, weil China in Zukunft weniger Rohstoffe und Investitionsgüter importieren wird. Die Umstrukturierung wäre den Chinesen besser gelungen, wenn sich die Exporte nach Europa und in die USA nicht deutlich abgeschwächt hätten wegen der dort müden Konjunktur. Als Folge musste China die Industrieproduktion drosseln. Inzwischen hat ja auch die Weltbank ihre globale Konjunkturprognose für 2016 von einem Plus von 3,3 % auf 2,9 % gesenkt.
Eine schlechte Nachricht – auch für Europa, oder?
Nein, bei nüchterner Betrachtung der wichtigsten Indikatoren zeigt sich, dass es in Europa dennoch in allen Ländern konjunkturell aufwärts geht. Die Konjunkturindikatoren der EU sind auf 4-Jahreshoch, die Arbeitslosigkeit nimmt ab und in Deutschland sind die Auftragseingänge überraschend stark gestiegen.
Und in den USA?
Dort bremst der starke Dollar die Konjunktur zwar etwas, aber der Arbeitsmarkt ist sehr stark. Andererseits wirkt das billige Öl wie ein Konjunkturprogramm für die USA und die ganze Welt.
Der Weltwirtschaft droht also kein Einbruch?
So ist es. Die Weltwirtschaft befindet sich weiter in einem moderaten Konjunkturaufschwung. Gelegentliche Turbulenzen an den Börsen entstehen aus Angst vor Anpassungsschocks im Zuge eines Strukturwandels. Dass das nicht schmerzlos ablaufen kann, ist klar. Die fundamentale Lage in China ist aber besser als die Stimmung. Das wird über kurz oder lang dazu führen, dass sich die Börsen in China und vor allem in Europa beruhigen. Sie werden ihren langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen.
Die meisten Deutschen deponieren ihr Geld aber weiterhin auf Sparkonten. Sie plädieren – nicht ganz unerwartet – für Aktien. Was spricht dafür in der jetzigen Lage?
Die Niedrigstzinspolitik der EZB wird noch für einige Zeit andauern. EZB-Chef Draghi will die Inflation im Euroland im Schnitt mit allen Mitteln auf die Zielgröße „nahe 2 %“ bringen. In konjunkturell starken Ländern wie Deutschland dürfte das eine Inflationsrate von 3 % und mehr bedeuten. Vor den dann drohenden Vermögenseinbußen können sich Anleger nur mit Aktien schützen. Sie sind langfristig nicht nur die ertragsreichste Anlageform, sondern bieten auch Schutz vor Inflation.
Konkret: Was bringt das Börsenjahr 2016?
Europäische Aktien bieten die besten Chancen – auch weil sie fundamental billiger sind im Vergleich zu anderen Börsen. Im weiteren Jahresverlauf erwarte ich, dass Emerging Markets- und Öl- und Rohstoffwerte, die sich teilweise mehr als halbiert haben, wieder attraktiv werden.
Wie wird sich die deutsche Börse in diesem Jahr schlagen?
Die deutsche Wirtschaft wird auch 2016 auf leicht ansteigendem Wachstumspfad bleiben. Und das ist günstig für die Börse, weil ihr genügend Kapital zur Verfügung steht – es fließt kaum in die Realwirtschaft ab. Ferner dürfte die deutsche Börse von der Wall Street beflügelt werden.
Warum das?
Das vierte Amtsjahr eines Präsidenten ist immer das beste Börsenjahr. In der Regel passiert vor der Wahl politisch nichts, was die US-Börse stört. Die Entwicklung in Deutschland hängt stark von der Wall Street ab, weil der größte Teil der Dax-Werte in anglo-amerikanischer Hand ist. Deshalb wird die Stimmung an der Wall Street auch den Handel auf dem deutschen Parkett bestimmen. Das Übergewicht ausländischer Großinvestoren bewirkt aber auch, dass der Dax 2016 erneut eine hohe Volatilität aufweisen wird.
Warum das?
Die hohe Volatilität hängt damit zusammen, dass der Aktienhandel mittlerweile zu mehr als 70 % von Computern gesteuert wird. Wenn eine bestimmte Kursschwelle über- oder unterschritten wird, werden fast gleichzeitig von vielen Computern automatisch Käufe oder Verkäufe ausgelöst. Da heute ein Vielfaches des Kapitals von vor 30 oder 40 Jahren im Spiel ist, nehmen die Schwankungen zu.
Auf welche Branchen sollte man 2016 besonders achten?
Auf die Rohstoffaktien, darunter vor allem die Ölwerte, habe ich bereits hingewiesen. Auch Automobilwerte und deren Zulieferer sollten sich aufgrund der guten Rahmenbedingungen – ich denke dabei insbesondere an das Auslandsgeschäft – gut entwickeln. Allerdings muss man VW besonders kritisch betrachten.
Und der Konsumsektor?
Der ist auch interessant. Allerdings findet man hier nur wenige deutsche Werte; man muss sich daher international umschauen.Ich glaube auch, dass die Aktien der Energieversorger – nach ihrem steilen Absturz – wieder anziehen könnten: Der finanzielle Druck auf die, von den Dividenden der Versorger abhängigen Kommunen, vor allem im Ruhrgebiet – wächst und kann auf Dauer von der Politik nicht negiert werden. Schließlich werden sie auch im Hinblick auf die Energiesicherheit noch gebraucht. Die Versorger dürften daher für langfristig orientierte Anleger einen Blick wert sein.
Und welche Werte sollte man meiden?
Die Technologieaktien sind ziemlich ausgereizt. Und Bankaktien habe ich längst nicht mehr auf meiner Rechnung.
Wer kurzfristig agiert lebt gefährlich
Ist die Börse wirklich noch ein Platz für private Anleger?
Ja, gefährlich lebt nur, wer kurzfristig agiert. Der private Anleger profitiert, indem er nicht auf die Aufs und Abs der Kurse reagiert, sondern langfristig investiert und die Schwankungen aussitzt. Dann kann er die smarten Großinvestoren mit ihren schnellen Computern sogar übertrumpfen. Während für Spekulanten das richtige Timing entscheidend ist, ist für den Privatanleger die Zeitachse wichtig. Deshalb habe ich in der neuesten Auflage meines Buches „Der einfache Weg zum Wohlstand“ eine Depot-Systematik für den Privatanleger entwickelt. Sie minimiert das Risiko, aber setzt gleichzeitig auf Ertragsstärke – und das klappt. Ein möglichst risikoarmes aber ertragsstarkes Depot muss aufgestellt sein wie eine gute Fußballmannschaft: Man hat vorn die Flitzer und hinten die Recken und mitten drin die Stabilisatoren. Aber nochmals: Eine entsprechende Depotstruktur von Aktien wirkt nur bei langfristiger Anlage. Sie verschafft dem privaten Investor die Möglichkeit, seine Zukunft finanziell abzusichern, was mit Zinsanlagen nicht mehr möglich ist.
Und wie funktioniert das?
Empirisch erwiesen ist, dass es Aktienklassen gibt, die langfristig überlegen sind. Es handelt sich um dividendenstarke Substanzwerte, auch Valueaktien genannt und um „Small Caps“, also Werte kleiner und mittlerer Unternehmen – wie wir sie zum Beispiel im MDax finden. Hinzu kommen Aktien der Emerging Markets. Zwar leiden letztere derzeit stark, sie bieten aber gerade deshalb langfristig große Chancen, weil sie aufgrund der gesunden Demografie in diesen Ländern ein dynamischeres Wachstum als die Industrieländer schaffen. Das Depot sollte international breit aufgestellt sein. Das lässt sich mit wenig Aufwand mit Hilfe von modernen Anlagevehikeln, den Indexfonds – auch ETFs genannt – die an der Börse wie Aktien gehandelt werden, erstellen. Man kann damit die 30 Werte des Dax oder die 50 Werte des M-Dax, oder auch den Dow Jones und andere Indices, ohne Ausgabeaufschlag als Aktie kaufen. Diese ETFs sind sehr kostengünstig und eignen sich besonders für Sparpläne. In meinem Buch nenne ich ausgewählte ETFs.
Die EZB setzt ihren expansiven geldpolitischen Kurs verschärft fort. Die Märkte reagierten dennoch enttäuscht. Warum?
Die Börsen hatten eine stärkere Anhebung des Strafzinses und eine weitere Senkung des Leitzinses erwartet aufgrund vorangegangener Andeutungen von EZB-Präsident Draghi. In diese Äußerungen hatten viele Börsianer zu viel hineininterpretiert.
Ist Draghis Fluten der Märkte mit billigem Geld nun vom EZB-Rat ein wenig gebremst worden?
Der Deutsche Bundesbank-Präsident Jens Weidmann galt im EZB-Rat als einsamer Rufer gegen die Übermacht der Vertreter der hoch verschuldeten südlichen Euro-Staaten. Das beginnt sich zu ändern. Die FAZ titelte Ende 2015: „Draghi verliert den Rückhalt der deutschen Eliten“. Laut „Entscheider-Panel „ der FAZ bescheinigen dem EZB-Präsidenten nur noch knapp die Hälfte der deutschen Eliten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung „gute Arbeit“. Im Jahr 2012 betrug die Zustimmung noch 57 %. Die Niedrigzinspolitik der EZB halten 52 % für falsch und die Käufe von Staatsanleihen hoch verschuldeter Euroländer sogar 73 %.
Aber Herr Weidmann bleibt ein einsamer Rufer?
Sicherlich wird der EZB-Chef alles tun, den hoch verschuldeten romanischen Euro-Ländern weiterhin jegliche geldpolitische Hilfe zu gewähren – sei es inner- oder außerhalb seines Mandates. Aber inzwischen scheint Draghi keine völlig frei Hand mehr zu haben: Jetzt wird Weidmann durch die deutschen Eliten gestärkt. Und wenn das Urteil dieser Eliten über die europäische Geldpolitik ins Negative umschlägt, dann bleibt das auch nicht ohne Einfluss auf die Stimmung anderer Euroländer, was Draghi auf Dauer nicht negieren kann.
Welchen Einfluss haben denn andere Notenbanken auf die Entscheidungen der EZB?
Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Die führenden Notenbanken der Welt – vor allem die europäische, die britische, die amerikanische und die japanische – stehen in engem Kontakt untereinander. So betrachtet die amerikanische Notenbank FED den seit längerem fallenden Euro – mit Blick auf die eigene Exportwirtschaft – sehr kritisch. Ob es mittelfristig zur Parität von Euro und Dollar kommt ist, so glaube ich, deshalb nicht sicher.
Ist die europäische Geldpolitik an ihre Grenzen gestoßen?
Die europäische Geldpolitik ist schon längst an ihre Grenzen gestoßen, wie sie in den Statuten der EZB festgeschrieben sind. Die Finanzierung einzelner Staaten ist nicht ihre Aufgabe. Ich bin auch erschüttert darüber, wie der Maastricht-Vertrag ohne ernsthafte Diskussionen 2010 gebrochen wurde. Mit dem Wort, das sei „alternativlos“ wurde der Vertragsbruch ungerührt sanktioniert. Wäre die No-Bail-Out-Klausel des Vertrages damals angewandt worden, hätten wir uns den fatalen Fall Griechenland erspart. Brüssel hätte lediglich Vertragstreue beweisen müssen und hätte damit ein deutliches Signal für die Zukunft gesetzt. Der ehemalige Oberkommandierende der Alliierten in Europa und spätere US-Präsident, Dwight D. Eisenhower, hat einmal gesagt: „Die Franzosen neigen dazu, alles zu unterschreiben und danach zu verhandeln“. Er hat Recht: Sie haben den Maastricht-Vertrag – die Grundlage der Währungsunion – unterschrieben und ihn dann anders interpretiert und systematisch ausgehöhlt.
Heute wissen wir, dass es damals um die französischen Banken ging, die für 70 Mrd. € griechische Anleihen in ihren Kellern gebunkert hatten?
Es ging darum, die französischen Banken zu retten, indem man Griechenland über Wasser hielt. Man hat damals dem massiven Druck Frankreichs nachgegeben ohne die Auswirkungen – vor allem die Kosten – einer Sanierung Griechenlands zu bedenken – einer Sanierung, die bis heute nicht gelungen ist.
Allerdings läuft die Konjunktur heute auch in den hoch verschuldeten Euroländern etwas besser?
Richtig, aber was dabei kaum noch Beachtung findet, ist die hohe Verschuldung. Sie vermindert sich nicht, im Gegenteil, sie steigt. Der niedrige Zins macht es den Schuldnern nicht nur erträglicher, die Lasten zu tragen; er wirkt auch verführerisch, neue Schulden zu machen, auch in Italien und Frankreich. Andererseits nutzen die Schuldnerländer den Spielraum, den ihnen die EZB in Form niedrigster Zinsen und einer Liquiditätsflut verschafft hat, nur unzureichend für Strukturreformen.
Droht der Euroraum zu einer Transferunion zu werden?
Es ist bereits eingetreten, was unsere Politiker bei der Einführung des Euro völlig ausgeschlossen hatten: Die Eurozone hat sich – durch die Hintertür, unter dem Deckmantel der EZB – zu einer Transferunion gewandelt. Zahlen tun die Nordstaaten – vor allem Deutschland.
Aber Sie meinen, dass sich unter den Vertretern der Nordstaaten im EZB-Rat langsam Unruhe breit macht?
Da bin ich mir ziemlich sicher; denn diese Politik, wird sie ungebremst fortgesetzt, würde auch eines Tages die Zahlmeister in der Währungsunion in den Bankrott treiben, es sei denn, die Nordländer ziehen vorher die Reißleine.
Und die Konjunktur und das Erreichen des Inflationszieles im Euroland bedürfen keiner geldpolitischen Unterstützung mehr?
Wie gesagt, die Konjunktur in der Eurozone erholt sich leicht und ich vermute, dieser Prozess wird sich – auch ohne weitere Hilfen durch die Geldpolitik – fortsetzen. Die Angst vor der Deflation ist völlig unbegründet, denn die niedrigen Inflationsraten sind vor allem Folge der eingebrochenen Rohstoffpreise – insbesondere des niedrigen Ölpreises.
Rohstoffpreise stehen vor ihrem Tiefpunkt
Bleiben die Rohstoffpreise für lange Zeit auf niedrigstem Niveau?
Nein, nur vorübergehend. Ich erwarte zwar nicht, dass der Ölpreis in absehbarer Zeit wieder auf alte Höhen zurückkehrt. Aber er dürfte in etwa seinen Tiefpunkt erreicht haben und im Verlauf des Jahres wieder anziehen – mit Auswirkungen auf die Inflation in Europa. Aufgrund des niedrigen Ölpreises müssen viele unrentabel gewordene Abbaukapazitäten stillgelegt werden, was das Angebot eher verknappt. Andererseits erwarte ich, dass sich die Weltwirtschaft langsam weiter erholt – mit der Folge, dass die Ölnachfrage steigen wird. Natürlich drängt auch der Iran wieder an den Ölmarkt, aber es braucht Zeit bis er seine Förderkapazitäten hochgefahren hat.
Sie sprachen die Inflation an, die kaum spürbar ist?
Das gilt nur für die Gegenwart. Bei wieder steigenden Rohstoffpreisen, einer fortschreitenden konjunkturellen Erholung und einem währungsbedingten Anstieg der Einfuhrpreise wird die Inflation in Europa ansteigen. Und nach dem bereits jahrelangen Zinsverzicht, der einer Enteignung der Sparer gleicht, kommt dann für sie noch die inflationsbedingte Geldentwertung hinzu. In der Altersvorsorge der Deutschen droht ein Debakel.
Welche Auswirkungen wird der Zinsschritt der FED auf die amerikanische Wirtschaft haben?
Die Fed hat die Wende in der US-Zinspolitik eingeleitet. Aber der Schritt hat vor allem symbolische Bedeutung: Er signalisiert, dass sich die Finanzmarktkrise dem Ende nähert und dass sich die FED rechtzeitig vor der Inflation wappnen will. Auf die Konjunktur haben Zinserhöhungen normalerweise einen bremsenden Effekt. Aber diesmal erwarte ich eine eher stimulierende Wirkung: Der bisher wirkende Attentismus – eine abwartende Haltung, vor allem bei den Investoren – geht zu Ende. Weil die Unternehmen und Häuslebauer damit rechnen, dass die Zinsen weiter steigen werden, wollen sie sich noch rasch die günstigen Konditionen sichern und werden tätig.
Das entzieht der US-Börse aber Mittel?
Nein, noch bleibt es dabei, Geld ist – auch bei sich belebender Investitionstätigkeit in der Realwirtschaft – ausreichend vorhanden. Die hohe Liquidität wird ja nicht abgebaut, sie erhöht sich insgesamt sogar noch: Die Fed fügt lediglich keine neue hinzu und die EZB druckt jeden Monat 60 Mrd. neues Geld, ähnlich viel wie die Bank of Japan. Und bezüglich des Zinses hat die US-Notenbank betont, dass der Leitzins für längere Zeit unterhalb der Marke liegen werde, die langfristig von ihr angepeilt wird. Mit raschen weiteren Zinsschritten ist aber auch aus politischen Gründen in den USA vorläufig nicht zu rechnen: Im Herbst 2016 finden dort Präsidentschaftswahlen statt. Die Notenbank hält sich in der Vorwahlzeit zurück, um nicht der Einmischung in den Wahlkampf bezichtigt zu werden. Ich bin also optimistisch für die Wall Street und wie ich bereits ausgeführt habe, auch für die deutsche und die europäischen Börsen.
Aber hier in Europa drohen politische Stürme: 2016 könnte ein Schicksaljahr für den alten Kontinent werden. Ein Brexit ist nicht auszuschließen. Und nachdem Griechenland und Portugal im letzten Jahr Linksregierungen bekommen haben, ist die Linke nun auch in Spanien entscheidend erstarkt. Polen hat dagegen rechts-konservativ gewählt. Zudem könnte der Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen eskalieren. Zerreisst es die EU?
Die Euroländer, die von der Austeritätspolitik betroffen sind driften jetzt politisch nach links ab. Frankreich und Italien mangelt es an wirtschaftlicher Stabilität, da auch sie ihre Verschuldung nicht im Griff haben. Nach rechts driften vor allem Polen und Ungarn, und die nordeuropäischen EU-Staaten halten sich zwischen diesen Extremen. Die Zentrifugalkräfte verstärken sich erheblich. Die Flüchtlingsfrage zeigt nur zu deutlich, wie wichtig ein politisch geeintes Europa wäre. Aber die EU strebt, statt politisch eng zusammenzurücken eher auseinander. Die mögliche Folge: Die EU wird sich schon bald neu ausrichten müssen.
… und mit Blick auf den Euro?
Den Euro wird es auch in fünf Jahren noch geben. Aber der Euro-Club ist mit den heutigen Mitgliedern auf Dauer nicht existenzfähig. Daher gehe ich davon aus, dass die Währungsunion sich hinsichtlich ihrer Mitglieder neu strukturieren und dann zum Maastricht-Vertrag zurückzukehren muss. Stabile Länder aus Ost- und Nordeuropa, die bisher der Währungsunion ferngeblieben sind, dürften hinzukommen. Allerdings glaube ich nicht, dass die Briten in absehbarer Zeit auf ihr Pfund verzichten.
Was bedeutet das für die deutsche Wirtschaft?
Sie steht vor großen Herausforderungen: Sie muss Konzepte entwickeln, möglichst viele der Immigranten möglichst rasch in den Arbeitsprozess eingliedern. Die Flüchtlingswelle wirkt wie eine Schocktherapie, die bei den Deutschen ihre besten Tugenden hervorbringt. Dank eines billigen Euros, niedriger Zinsen und tiefer Ölpreise herrschen günstige Rahmenbedingungen, so dass das Wirtschaftswachstum höher ausfallen dürfte, als bisher geschätzt.