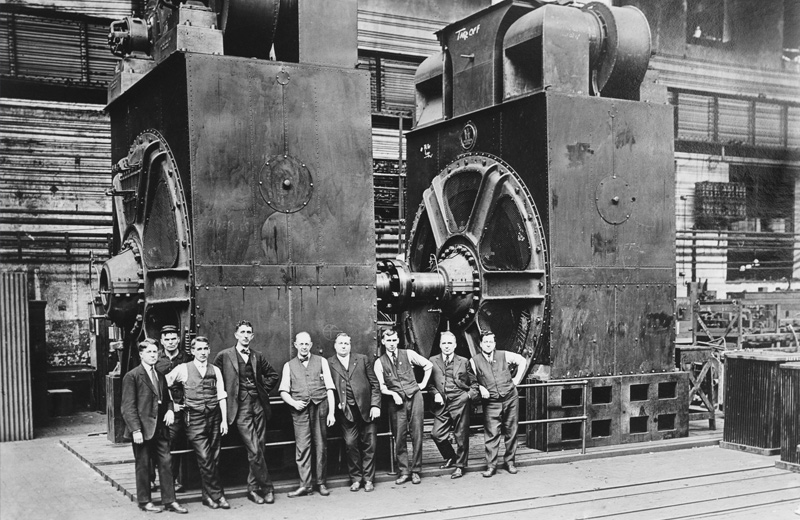Gottfried Heller zur Lage an den Kapitalmärkten, was André Kostolany nun tun würde und warum Geld für ihn nur ein Nebenprodukt ist.
von Christian Kirchner
Gottfried Heller, 80, ist Vermögensverwalter und Buchautor. 1971 gründete er mit dem langjährigen Capital-Kolumnisten André Kostolany die Fiduka Depotverwaltung. Hellers Buch „Der einfache Weg zum Wohlstand“ ging jüngst in die fünfte Auflage.
Capital: Herr Heller, Sie sind seit fast 50 Jahren als Vermögensverwalter tätig. Hand aufs Herz: War Geldanlage jemals so schwierig wie jetzt angesichts der Wahl zwischen extrem niedrigen Zinsen und den turbulenten Aktienmärkten?
Gottfried Heller: Ich finde die Situation überhaupt nicht schwierig. Sie wird von vielen Finanzdienstleistern wie Banken und Vertrieben aber gerne als besonders schwierig und kompliziert dargestellt – weil es nicht in ihrem Interesse ist, wenn Anleger ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen, etwa über Aktien ertragsstarker Unternehmen, deren Rendite langfristig alle anderen Anlagen übertrumpft.
Viele Anleger fürchten, sie seien Spielball eines gigantischen geldpolitischen Experiments mit ungewissem Ausgang.
Mein langjähriger Freund und Geschäftspartner André Kostolany brachte das gut auf den Punkt, indem er sich über Leute lustig machte, die sich über die Unberechenbarkeit der Börsen mokierten. „Ja meinen Sie denn, die Börse war jemals berechenbar?“, pflegte er dann zu fragen. Das passt derzeit gut zur Lage: Sorgen um China, Öl, vor geopolitischen Spannungen oder der Zinswende – das sind alles keine neuen Phänomene.
Dass die Kurse seit nunmehr fast sieben Jahren wieder klettern, sorgt sie nicht? Die Nervosität ist doch gerade seit Jahresbeginn greifbar.
Nein, zumindest nicht, solange man einen ausreichend langen Anlagehorizont hat: In den einfachsten und wichtigsten Kennziffern wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis oder der Dividendenrendite sind Aktien nicht zu teuer. Und: Nach dem Beginn von Leitzinserhöhungen kletterten Aktien etwa in den USA in der Vergangenheit im Schnitt noch drei weitere Jahre. Daher verstehe ich auch nicht, wieso Anleger so sehr auf den ersten Mini-Zinsschritt der US-Notenbank starren – leider ein schlechtes Beispiel für einen „Informations-Overkill“ für Anleger. Hüten Sie sich davor. Das hat langfristig doch keine Bedeutung für die Renditen!
Auf Basis Ihrer langjährigen Erfahrung: Woher kommt denn die tiefe Skepsis deutscher Anleger gegenüber der Aktienanlage?
Die kulturelle Prägung ist wichtig. Gerade im Vergleich zu angelsächsischen Ländern kommt mir häufig der Gedanke zu kurz, dass mit dem Ende der Nazidiktatur fast die komplette, jüdisch geprägte finanzielle Intelligenz des Bank- und Börsenwesens entweder ermordet war oder ausgewandert ist. Dass auf diesem Fundament keine gute finanzielle Bildung entstehen konnte, ist kein Wunder. Hinzu kommt, dass die Anleger das Gefühl haben: Der Staat wird es für mich schon richten, ich muss privat nicht vorsorgen. Das führt aber geradewegs in die finanzielle Katastrophe bei unserer demografischen Entwicklung, sofern Menschen nicht umdenken. Dabei ist es – anders, als in vielen Medien und von Finanzunternehmen dargestellt – so günstig wie nie, rentabel ein Vermögen über Aktien aufzubauen, etwa über Indexfonds (ETFs). Das war bis in die 90er-Jahre weitaus teurer.
Gab und gibt es denn keine Momente, in denen auch Sie es einmal mit der Angst zu tun bekommen, dass wir in eine handfeste Krise rutschen und man sein Geld besser in Sicherheit bringt?
Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde: nein, die gibt es nicht. Aber ich habe in meinen 45 Jahren Arbeit als Vermögensverwalter gelernt, dass es kaum möglich ist, mit hektischen Transaktionen die Rendite zu steigern und andererseits genau solche Angstmomente häufig sensationelle Kaufgelegenheiten darstellen. Zu jeder Krise gehört, dass auf allen Kanälen die Deutung folgt, an den Kapitalmärkten sei nun nichts mehr so wie vorher und die Welt eine andere. Zum Beispiel beim Crash 1987, als die Kurse über ein Fünftel eingebrochen sind binnen Stunden. Ich sortierte meine Zahlen, hatte eine sehr kurze Nacht, bemerkte, welche hervorragenden Opportunitäten sich ergaben, rief als Vermögensverwalter meine Bank an und orderte Standardwerte. Am anderen Ende der Leitung gab es nur fassungsloses Entsetzen. „Sie wollen kaufen?“, fragte mich der Mitarbeiter entgeistert. „Sie sind heute der erste, der kauft und nicht verkauft!“, erklärte er mir. Denn die Zeitungen waren schließlich voll von Analysen, dass der Crash die Renditen über Jahre ruinieren würde. Da wusste ich: Ich muss eigentlich mehr kaufen. Die Herausforderung als Vermögensverwalter, wenn Krisen aufziehen, ist eine andere.
Nämlich?
Den Kunden zu überzeugen, dass er gute Nerven bewahren sollte und nicht kopflos verkaufen, nur wenn es andere tun. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, mit Kunden gemeinsam zu zittern um ihr Geld, wenn diese zur Panik neigten. Aber gute Nerven bringen langfristig nun mal die beste Rendite. Kostolany lag diese antizyklische Haltung im Blut, ich musste sie erst lernen.
Apropos Blut: Lag Ihnen die Beschäftigung mit Geldanlage schon immer im Blut?
(lacht) Nein, überhaupt nicht. was mir immer im Blut lag war der Wunsch, einmal nach Amerika zu gehen. Ich habe in Deutschland Ende der 50er-Jahre eine Karriere als Unternehmensberater begonnen. 1963, mit 28 Jahren, warf ich diesen Beruf hin und ging in die USA. In einem Zimmer einer Verwandten fand ich Unterschlupf und fing buchstäblich bei null an und arbeitete mich wieder hoch vom einfachen Angestellten zu einem Unternehmensberater. Eine herrliche Zeit. Ende der 60er-Jahre war ich vermutlich einer der ersten echten Vielflieger der Welt, es ging laufend hin- und her zwischen den US-Großstädten. Einer meiner Kollegen faszinierte mich dann aber sehr: er verdiente sehr viel Geld, weil er einiges anders machte als die Masse: Statt Wohneigentum zu kaufen, mietete er, weil sein Geld an der Börse rascher wuchs. Sein Tag begann nicht mit einem Frühstück, sondern erst einmal mit einem halbstündigen Telefonat mit seinem Broker. Da dachte ich, noch etwas naiv: das klingt ja interessant, so etwas gibt es in Deutschland ja kaum.
Schwierige Anfangsjahre
Wie landeten Sie dann als Vermögensberater?
Ich erhielt das Angebot, zurück nach Deutschland zu gehen und hier den Vertrieb von Investmentfonds aufzubauen. Das erschien mir eine tolle Gelegenheit, schließlich rechnete ich damit, dass sich auch immer mehr Deutsche für diese rentable Form der Geldanlage würden begeistern können, die in den USA schon so gut funktionierte. Das endete allerdings in einem ziemlichen Desaster.
Weil die Deutschen doch keine Fonds kaufen wollten?
Nein, ich erhielt meine erste große Lektion über Zyklen der Anlegerstimmung und der Regulierung: In Deutschland waren damals die „IOS“-Fonds von Bernie Cornfeld ein ganz heißes Ding. Angeblich hoch rentabel, aber, wie man später erfuhr, ein Schneeballsystem. Mein späterer Freund André Kostolany hat sich übrigens mit Ihrem Magazin und seinem damaligen Chefredakteur damals einen heftigen Streit geliefert, weil er in seiner Kolumne vor IOS warnte, aber das Magazin ansonsten sehr begeistert war von den Fonds.
Kostolany behielt Recht.
Genau. 1970 und damit kurz nach meinem Start mit dem Vertrieb seriöser Produkte, brach das IOS-System zusammen. Daraufhin wollten Privatanleger überhaupt nichts mehr von Fonds wissen und nahmen den ganzen Bereich der Geldanlage in eine Sippenhaft des Misstrauens. Gleichzeitig forcierte die Politik eine stärkere, teils allerdings ins Groteske abgleitende Regulierung von Fonds und Beratung zum Schutz von Privatanlegern. Das kommt Ihnen womöglich bekannt vor, oder? Die Politik hat leider eine lange Tradition in Bonn und Berlin, dem zarten Pflänzchen Aktienkultur in Deutschland immer wieder den Kopf abzuschlagen, ehe es Früchte trägt. Das Thema Vermögensaufbau über Fonds und Aktien war daher tot, über Jahre hinweg. Ich hielt allerdings an dem Plan fest.
Wie kam es dann zur Zusammenarbeit mit André Kostolany?
Mit einer erprobten Methode: Ich hatte schon meine Frau, eine gebürtige Britin, in New York näher kennengelernt, indem ich ihr vorschlug, wir könnten ja etwas an den Defiziten der deutsch-britischen Beziehungen ändern. Den damals sehr prominenten Kostolany sprach ich 1970 am Rande einer Veranstaltung an: Er beklage in seinen Capital-Kolumnen ja immer die Defizite der Deutschen in der Geldanlage – ob wir denn nicht gemeinsam an diesen Defiziten arbeiten wollten?
Und er wollte?
Ja. Aber wir hatten schwierige Jahre, ehe wir 1974 auf einer nächtlichen Autobahnfahrt durch strömenden Regen die Idee hatten, nicht nur Vermögensverwaltung anzubieten, sondern auch Börsenseminare an Wochenenden zu veranstalten. Das war der Durchbruch.
Wann kam die erste Million?
Exakt sagen kann ich das nicht, denn mir war finanzielle Unabhängigkeit immer wichtig. Bloß keine Kredite! Folglich blieb auch jeder Cent im Unternehmen. Reich werden, das war nie mein Ziel. Wenn ich das gewollt hätte, wäre ich auf die vielen Verlockungen hereingefallen, auf die windigen Empfehlungen, über Immobilienfonds oder Steuersparmodelle schnelle 15 bis 20 Prozent Provision zu machen. Geld war ein Nebenprodukt, weil die Firma ja nur dann profitierte, wenn auch die Kunden Erfolg hatten. Nimmt man aber das Interesse anderer an einer Übernahme als Maßstab, war die Million Mitte der 80er-Jahre überschritten.
Es klingt einigermaßen erstaunlich, dass Sie die aktuelle Kapitalmarktphase aus Sicht eines Vermögensverwalters als gar nicht so besonders empfinden.
Weil sich die Themen oft wiederholen. Es gibt fraglos eine Reihe großer Trends: Niedrigeres Wirtschaftswachstum, globaler Schuldenabbau, eine alternde Bevölkerung in Industrieländern – das sind eher Belastungsfaktoren. Aber es gibt auch strukturelle Trends, von denen man profitieren kann, etwas das Wachstum der Schwellenländer oder die steigende Ressourcennachfrage. Die letzten beiden Punkte haben sogar eine ziemlich schlechte Presse derzeit. Aber diese Trends stellen die ganz grundlegenden Gesetze der Geldanlage nicht auf den Kopf – und auch nicht die Attraktivität der Aktien.
„In Krisensituationen die Nerven behalten“
Einmal auf den Punkt gebracht: Wie hält man sich über vier Jahrzehnte als Vermögensverwalter im Geschäft, ohne Schiffbruch zu erleiden angesichts der vielen Crashs und Brüche?
Erstens: Mir war stets wichtig, eine weiße Weste zu behalten, wenn es um den Graumarkt ging, etwa in Schiffs- oder Immobilienfonds oder sonstige Abschreibungsgesellschaften bei denen auch Steuerersparnisse ins Spiel kamen. Hier waren für Berater schnell einmal 20 Prozent Provision der Anlagesumme zu verdienen. Davon haben wir stets die Finger gelassen, auch wenn dies leicht verdientes Geld gewesen wäre in den 70er- und 80er-Jahren. Das haben Kunden honoriert. Zweitens habe ich die Firma nie des Geldes wegen betrieben. Es ging uns und mir immer darum, dass die Kunden Erfolg haben. Dass man damit Geld verdient hat, fiel quasi ab. Daher haben wir auch immer sehr viele Mittel in der Firma gelassen, um unabhängig zu bleiben, statt uns abhängig von Banken zu machen. Drittens ist es für eine erfolgreiche Geldanlage entscheidend, in Krisensituationen die Nerven zu behalten. Das hieß oft: Lange Wochen und Monate mit den Kunden zu zittern, wenn es an den Märkten einmal gerappelt hat. In solchen Situationen sind Verwalter gefragt.
Wenn Sie Anlegern eine Anlage empfehlen dürften, welche wäre das?
Das lässt sich pauschal nicht sagen, wichtig ist, zunächst die Risikotragfähigkeit zu ermitteln. Das kann aber auch jeder Anleger selbst, ich habe dazu für mein Buch „Der einfache Weg zum Wohlstand“ einen Selbsttest entwickelt. Die Aktienanlage selbst muss gar nicht kompliziert sein, es gibt etwa Indexfonds, auch ETFs genannt, mit denen Anleger mit einem Papier einen ganzen Index kaufen können. Damit können sie ohne großen Aufwand und dazu noch sehr kostengünstig ein internationales Wertpapierdepot zusammenstellen, das breit diversifiziert ist und dadurch ein viel geringeres Risiko aufweist als ein Depot mit Einzelaktien. Ich habe dazu eine Systematik entwickelt, die sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert. Mit acht bis zehn ETFs auf die langfristig ertragsstärksten Aktienklassen können Anleger damit die Rendite steigern und gleichzeitig das Risiko vermindern – quasi die Quadratur des Kreises. Zu diesen Aktienklassen zählen Value-Aktien, also Substanzwerte mit hoher Dividendenrendite, kleine und mittelgroße Werte und Schwellenländer-Aktien.