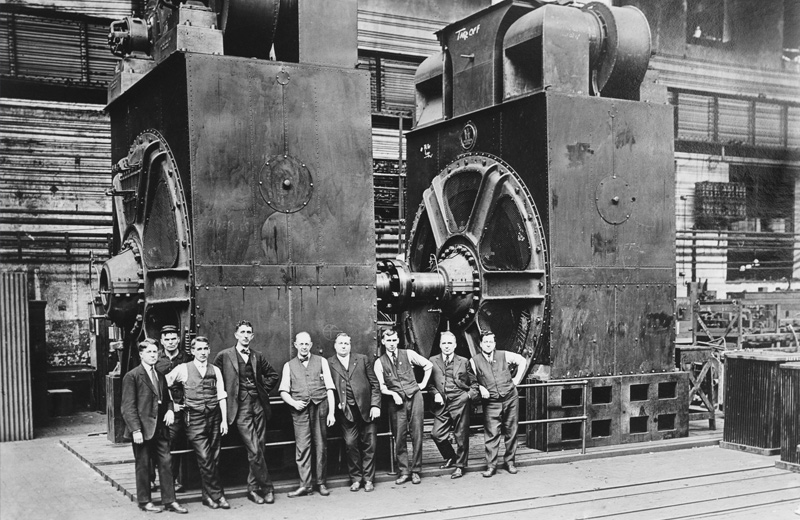Der Dax hat in den ersten Wochen dieses Jahres bereits knapp zehn Prozent verloren. Ist die gegenwärtige Abwärtsbewegung nur eine vorübergehende Korrektur oder steht uns eine veritable Baisse – und damit eine Trendumkehr – bevor?
Gottfried Heller: Nein, die Börsen verhalten sich derzeit völlig irrational, so wie sie das schon mehrmals in dieser Haussebewegung gemacht und heftige Korrekturen ausgelöst haben – und wie ich es schon oft in meiner 45-jährigen Börsenkarriere erlebt habe.
An welchen Fakten machen Sie das fest?
Der billige Ölpreis ist nicht ein Indiz einer schlechteren weltweiten Wirtschaftslage, sondern er ist die Folge eines temporären Überangebots von Öl, das durch den Iran nach Aufhebung der Sanktionen mittelfristig noch erhöht wird. Es wird von den Märkten völlig ignoriert, dass der Ölpreis wie ein riesiges Konjunkturprogramm wirkt, weil er für etwa 80 Prozent der Menschheit die Kaufkraft um rund 1,3 Billionen Dollar erhöht. Dies wird in erster Linie dem Konsum zugutekommen.
Auch die heftigen Börsenturbulenzen in China sind vorwiegend technischer Natur. Sie haben ihren Ursprung bei den A- und B-Aktien, die fast ausschließlich von unerfahrenen chinesischen Privatanlegern gekauft wurden und das häufig mit hohen Kredithebeln. Diese Spekulationsblase wird sich in absehbarer Zeit entleert haben. Die Weltwirtschaft befindet sich dagegen weiter in einem moderaten Konjunkturaufschwung. Das, sowie eine gigantische Geldschwemme, ein tiefer Ölpreis und Zinsen nahe Null sind beste Voraussetzungen für steigende Aktienkurse. Die Bewertungen und, mehr noch, die Dividendenrenditen sind jetzt vor allem in Europa und Asien wieder sehr günstig. Es gibt angesichts der Nullzinsphase keine vernünftige Alternative zu Aktien.
Sind die gegenwärtigen Kurse eine Gelegenheit, sich günstig einzudecken?
Der aktuelle Kursrutsch bietet sich für günstige Käufe an, wobei aber jedem Anleger klar sein muss: Wenn die Märkte verrückt spielen, dann gründlich. Die Korrektur kann deshalb noch eine Weile andauern. Daher sollten Käufe nicht auf einmal, sondern in mehreren Teilbeträgen – am besten an schwachen Tagen – vorgenommen werden, um einen günstigen Mischkurs zu erzielen. Alte Kaufmannsregel: Der Gewinn liegt im billigen Einkauf. Für langfristig orientierte Anleger, die in soliden Aktien oder Fonds investiert sind, empfehle ich, stillzuhalten und die Turbulenzen auszusitzen.
Auf welche Titel und Sektoren sollten Anleger jetzt setzen?
Für Langfristanleger bieten sich jetzt bei Ölaktien mit hohen Dividenden, Rohstoffwerten, Automobil- und Pharmazietiteln und vor allem Konsumaktien angesichts der stark gefallenen Kurse sehr gute Chancen.
Welche Werte sollte man meiden?
Ich glaube die Technologieaktien sind ziemlich ausgereizt. Bankaktien habe ich längst nicht mehr auf meiner Rechnung.
Börsen im Wandel
Aktien bieten nach Ihren Ausführungen Chancen. Aber der Deutsche gilt als risikoscheu. Wird sich in dieser Zeit der hohen Volatilität an den Börsen die Scheu vor Aktien nicht eher noch vergrößern?
Die hohe Volatilität hängt auch damit zusammen, dass der Aktienhandel mittlerweile zu mehr als 70 Prozent von Computern gesteuert wird. Wenn eine bestimmte Kursschwelle über- oder unterschritten wird, werden fast gleichzeitig von vielen Computern automatisch Käufe oder Verkäufe ausgelöst. Da heute ein Vielfaches des Kapitals von vor 30 oder 40 Jahren im Spiel ist, werden die Schwankungen größer.
Also ist die Börse kein Platz für private Anleger?
Im Gegenteil, gefährlich lebt nur, wer kurzfristig agiert. Der private Anleger profitiert, indem er nicht auf das Auf und Ab der Kurse reagiert, sondern langfristig investiert und die Schwankungen aussitzt. Dann kann er die smarten Großinvestoren mit ihren schnellen Computern sogar übertrumpfen. Während für Spekulanten das richtige Timing entscheidend ist, ist für den Privatanleger die Zeitachse wichtig. Deshalb habe ich in der neuesten Auflage meines Buches „Der einfache Weg zum Wohlstand“ eine Depot-Systematik für Privatanleger entwickelt.
Wie funktioniert diese Systematik?
Sie minimiert das Risiko, aber setzt gleichzeitig auf Ertragsstärke – und das klappt. Ein möglichst risikoarmes aber ertragsstarkes Depot muss aufgestellt sein wie eine gute Fußballmannschaft: Man hat vorn die Flitzer und hinten die Recken und mitten drin die Stabilisatoren. Aber nochmals: Eine entsprechende Depotstruktur von Aktien wirkt nur bei langfristiger Anlage. Sie verschafft dem privaten Investor die Möglichkeit, seine Zukunft finanziell abzusichern, was mit Zinsanlagen nicht mehr möglich ist.
Wie sieht Ihre Depotstruktur aus?
Empirisch erwiesen ist, dass es Aktienklassen gibt, die langfristig überlegen sind. Es handelt sich um dividendenstarke Substanzwerte, auch Valueaktien genannt, und um „Small Caps“, also Werte kleiner und mittlerer Unternehmen, wie wir sie etwa im MDAX finden. Hinzu kommen Aktien der Emerging Markets. Zwar leiden letztere derzeit stark, sie bieten aber gerade deshalb langfristig große Chancen, weil sie aufgrund der gesunden Demografie in diesen Ländern ein dynamischeres Wachstum als die Industrieländer schaffen. Das Depot sollte international breit aufgestellt sein. Das lässt sich mit wenig Aufwand mit Hilfe von modernen Anlagevehikeln, den Indexfonds (ETF: Exchange-traded Fund, engl. für „börsengehandelter Fonds“) erstellen. Man kann damit die 30 Werte des DAX oder die 50 Werte des MDAX, oder auch den Dow Jones und andere Indices, ohne Ausgabeaufschlag als Aktie kaufen. Diese ETFs sind sehr kostengünstig und eignen sich besonders für Sparpläne. In meinem Buch nenne ich ausgewählte ETFs.
Draghi unter Druck
Die EZB setzt ihren expansiven geldpolitischen Kurs verschärft fort. Die Märkte reagierten dennoch enttäuscht. Woran liegt das?
Die Börsen hatten aufgrund vorangegangener Andeutungen von EZB-Präsident Draghi eine stärkere Anhebung des Strafzinses und eine weitere Senkung des Leitzinses erwartet. In diese Äußerungen hatten viele Börsianer zu viel hineininterpretiert.
Sie haben den unattraktiven Zins und die fortgesetzte expansive Geldpolitik der EZB bereits erwähnt, aber ist EZB-Chef Draghis Fluten der Märkte mit billigem Geld vom EZB-Rat jüngst nicht ein wenig gebremst worden?
Der Deutsche Bundesbank-Präsident Jens Weidmann galt im EZB-Rat als einsamer Rufer gegen die Übermacht der Vertreter der hoch verschuldeten südlichen Euro- Staaten. Das beginnt sich zu ändern. Die FAZ titelte Ende 2015: „Draghi verliert den Rückhalt der deutschen Eliten“. Laut dem „Entscheider-Panel“ der FAZ bescheinigen dem EZB-Präsidenten nur noch knapp die Hälfte der deutschen Eliten aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung „gute Arbeit“. Im Jahr 2012 betrug die Zustimmung noch 57 Prozent. Die Niedrigzinspolitik der EZB halten 52 Prozent für falsch und die Käufe von Staatsanleihen hoch verschuldeter Euroländer sogar 73 Prozent.
Aber Weidmann bleibt ein einsamer Rufer?
Sicherlich wird der EZB-Chef alles tun, den hoch verschuldeten romanischen Euro-Ländern weiterhin jegliche geldpolitische Hilfe zu gewähren – sei es inner- oder außerhalb seines Mandates. Aber inzwischen scheint Draghi nicht mehr völlig freie Hand zu haben: Jetzt wird Weidmann durch die deutschen Eliten gestärkt. Und wenn das Urteil dieser Eliten über die europäische Geldpolitik ins Negative umschlägt, dann bleibt das auch nicht ohne Einfluss auf die Stimmung anderer Euroländer, was Draghi auf Dauer nicht negieren kann.
Welchen Einfluss haben andere Notenbanken auf die Entscheidungen der EZB?
Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Die führenden Notenbanken der Welt – vor allem die europäische, die britische, die amerikanische und die japanische – stehen untereinander in engem Kontakt. So betrachtet die amerikanische Notenbank FED den seit längerem fallenden Euro – mit Blick auf die eigene Exportwirtschaft – sehr kritisch. Ob es mittelfristig zur Parität von Euro und Dollar kommt ist, so glaube ich, deshalb nicht sicher.
Ist die europäische Geldpolitik an ihre Grenzen gestoßen?
Die europäische Geldpolitik ist schon längst an ihre Grenzen gestoßen, wie sie in den Statuten der EZB festgeschrieben sind. Die Finanzierung einzelner Staaten ist nicht ihre Aufgabe. Ich bin auch erschüttert darüber, wie der Maastricht-Vertrag ohne ernsthafte Diskussionen 2010 gebrochen wurde. Mit dem Wort, das sei „alternativlos“ wurde der Vertragsbruch ungerührt sanktioniert. Wäre die No-Bailout-Klausel des Vertrages damals angewandt worden, hätten wir uns den fatalen Fall Griechenland erspart. Brüssel hätte lediglich Vertragstreue beweisen müssen und damit ein deutliches Signal für die Zukunft gesetzt. Der ehemalige Oberkommandierende der Alliierten in Europa und spätere US-Präsident, Dwight D. Eisenhower, hat einmal gesagt: „Die Franzosen neigen dazu, alles zu unterschreiben und danach zu verhandeln“. Er hat Recht: Sie haben den Maastricht-Vertrag – die Grundlage der Währungsunion – unterschrieben und ihn dann anders interpretiert und systematisch ausgehöhlt.
Damals ging es um die französischen Banken, die für 70 Milliarden Euro griechische Anleihen gebunkert hatten?
Es ging darum, die französischen Banken zu retten, indem man Griechenland über Wasser hielt. Man hat damals dem massiven Druck Frankreichs nachgegeben, ohne die Auswirkungen – vor allem die Kosten – einer Sanierung Griechenlands zu bedenke. Einer Sanierung, die bis heute nicht gelungen ist.Seite 4
Allerdings läuft die Konjunktur auch in den hochverschuldeten Euro-Ländern mittlerweile besser?
Richtig, aber was dabei kaum noch Beachtung findet, ist die hohe Verschuldung. Sie vermindert sich nicht, im Gegenteil, sie steigt. Der niedrige Zins macht es den Schuldnern nicht nur erträglicher, die Lasten zu tragen; er wirkt auch verführerisch, neue Schulden zu machen, auch in Italien und Frankreich. Andererseits nutzen die Schuldnerländer den Spielraum, den ihnen die EZB in Form niedrigster Zinsen und einer Liquiditätsflut verschafft hat, nur unzureichend für Strukturreformen.
Europa am Scheideweg
Droht der Euroraum zu einer Transferunion zu werden? Heller: Es ist bereits eingetreten, was unsere Politiker bei der Einführung des Euro völlig ausgeschlossen hatten: Die Eurozone hat sich – durch die Hintertür, unter dem Deckmantel der EZB – zu einer Transferunion gewandelt. Zahlen tun die Nordstaaten – vor allem Deutschland.
Sie meinen, dass sich unter den Vertretern der Nordstaaten im EZB-Rat langsam Unruhe breitmacht?
Da bin ich mir ziemlich sicher; denn diese Politik, wird sie ungebremst fortgesetzt, würde auch eines Tages die Zahlmeister in der Währungsunion in den Bankrott treiben, es sei denn, die Nordländer ziehen vorher die Reißleine.
Die Konjunktur und das Erreichen des Inflationszieles im Euroland bedürfen keiner geldpolitischen Unterstützung mehr?
Wie gesagt, die Konjunktur in der Eurozone erholt sich leicht und ich vermute, dieser Prozess wird sich – auch ohne weitere Hilfen durch die Geldpolitik – fortsetzen. Die Angst vor Deflation ist völlig unbegründet, denn die niedrigen Inflationsraten sind vor allem Folge der eingebrochenen Rohstoffpreise – vor allem des niedrigen Ölpreises.
Die kaum spürbare Inflation als verlässliche Größe?
Das gilt nur für die Gegenwart. Bei wieder steigenden Rohstoffpreisen, einer fortschreitenden konjunkturellen Erholung und einem währungsbedingten Anstieg der Einfuhrpreise wird die Inflation in Europa ansteigen. Und nach dem bereits jahrelangen Zinsverzicht, der einer Enteignung der Sparer gleicht, kommt dann für sie noch die inflationsbedingte Geldentwertung hinzu. In der Altersvorsorge der Deutschen droht ein Debakel.
2016 könnte ein Schicksalsjahr für Europa werden. Ein Brexit ist nicht auszuschließen und nachdem Griechenland und Portugal im letzten Jahr Linksregierungen bekommen haben, ist die Linke nun auch in Spanien entscheidend erstarkt. Polen hat dagegen rechts-konservativ gewählt. Zudem könnte der Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen eskalieren. Zerreißt es die EU?
Die Euroländer, die von der Austeritätspolitik betroffen sind, driften jetzt politisch nach links ab. Frankreich und Italien mangelt es an wirtschaftlicher Stabilität, da auch sie ihre Verschuldung nicht im Griff haben. Nach rechts driften vor allem Polen und Ungarn, die nordeuropäischen EU-Staaten halten sich zwischen diesen Extremen. Die Zentrifugalkräfte verstärken sich erheblich. Die Flüchtlingsfrage zeigt nur zu deutlich, wie wichtig ein politisch geeintes Europa wäre. Aber die EU strebt, statt politisch enger zusammenzurücken, eher auseinander. Die mögliche Folge: Die EU wird sich schon bald neu ausrichten müssen.
Wird das Auswirkungen auf den Euro haben?
Den Euro wird es auch in fünf Jahren noch geben. Aber der Euro-Club ist mit den heutigen Mitgliedern auf Dauer nicht existenzfähig. Daher gehe ich davon aus, dass die Währungsunion sich hinsichtlich ihrer Mitglieder neu strukturieren und dann zum Maastricht-Vertrag zurückzukehren muss. Stabile Länder aus Ost- und Nordeuropa, die bisher der Währungsunion ferngeblieben sind, dürften hinzukommen. Allerdings glaube ich nicht, dass die Briten in absehbarer Zeit auf ihr Pfund verzichten.
Was kommt da auf die deutsche Wirtschaft zu?
Sie steht vor großen Herausforderungen: Sie muss möglichst viele Konzepte entwickeln und die Immigranten rasch in den Arbeitsprozess eingliedern. Die Flüchtlingswelle wirkt wie eine Schocktherapie, die bei den Deutschen ihre besten Tugenden hervorbringt. Dank des billigen Euros, niedriger Zinsen und tiefer Ölpreise herrschen günstige Rahmenbedingungen, sodass das Wirtschaftswachstum höher ausfallen dürfte, als bisher geschätzt.