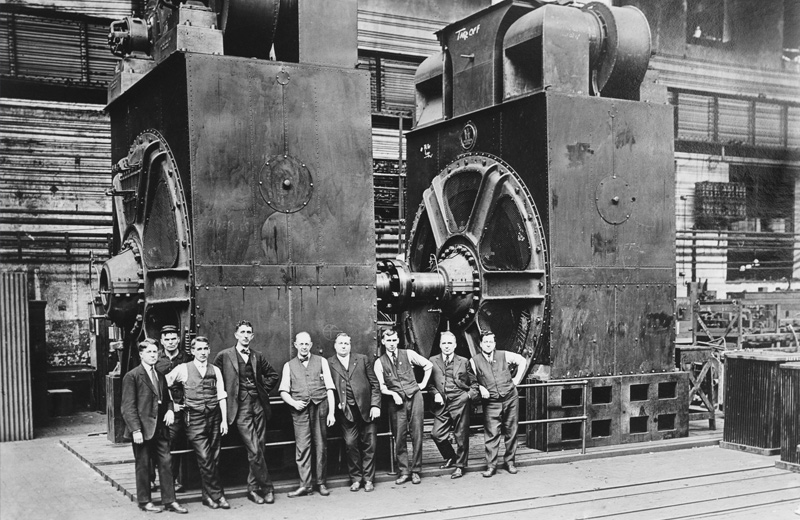Angela Merkel ist sauer. Mal wieder. Hat es doch der DGB gewagt, so kurz vor der Bundestagswahl auf die Krise der Rentenversicherung aufmerksam zu machen. Das befördere, klagte die Kanzlerin, ohne Not die Angst vor Altersarmut. Und das nutze der AfD. Mit diesem Totschlagargument kann sie aber nicht jedes Problem unter den Teppich kehren. Vor allem dann nicht, wenn es so himmelschreiend ist wie bei der Altersvorsorge.
Die Kanzlerin hätte nur ihre Sozialministerin Andrea Nahles fragen müssen. Die hatte Ende September alarmierende Ergebnisse vorgestellt: Wenn alles bleibt wie es ist, wird das gesetzliche Rentenniveau von 47,8% bis 2030 auf 44% und bis 2045 auf 41,6% fallen. 2001 waren es noch 52,6% des Durchschnittslohns. Trotzdem von drohender Altersarmut keine Spur, meint Merkel. Was nicht sein darf, kann auch nicht sein.
Dabei sind die neuen Zahlen von der Tendenz her längst bekannt. 2012 hatte die damalige Sozialministerin von der Leyen vorgerechnet, 2030 müssten Arbeitnehmer, die weniger als 2500 Euro verdienen, „mit dem Tag des Renteneintritts den Gang zum Sozialamt“ antreten. Dabei fangen die Probleme ab 2030 erst richtig an, weil dann die geburtenstärksten Jahrgänge in Rente gehen.
Aber statt überfällige Reformen – auch schmerzhafte – durchzuführen, die von Schwarz-Rot mit 80% Stimmenmehrheit leicht umsetzbar gewesen wären, hat Kanzlerin Merkel die Chance leichtfertig vertan und das Thema „Rente“ in der Schublade versenkt.
Mit ihrem üblichen Aussitzen hat sie wertvolle Zeit vergeudet, Zeit, die eine Reform der Alterssicherung nicht hat. Stattdessen verteilte die „GroKo“ mit abschlagfreier Rente mit 63 und Mütterrente neue Wohltaten, die bis 2030 zusätzlich 130 Milliarden Euro kosten. Falls Frau Nahles in ihrem für November angekündigten neuen Rentenkonzept die Forderung ihres Parteichefs Sigmar Gabriel und des DGB erfüllt, das Rentenniveau auf dem jetzigen Stand einzufrieren, wird alles noch viel teurer – 2030 entstünden Mehrkosten von jährlich 19 Milliarden Euro und 2045 von sage und schreibe 40 Milliarden Euro. Finanziert werden müsste das mit einem Sprung des Beitragssatzes von 18,7% auf 26,4%. Nahles hat die Schleusen schon geöffnet und erklärt, die Beiträge blieben „nicht bei den 22% stehen“, die als Höchstgrenze bis 2030 festgeschrieben sind.
Wie man es dreht und wendet, die Regierung hat nur drei Stellschrauben: die Rentenhöhe, den Beitragssatz und das Renteneintrittsalter. Mal ist die Lösung zu teuer, mal menschlich nicht zumutbar oder ideologisch nicht akzeptabel. Die Rechenakrobaten im Sozialministerium mühen sich vergeblich: Der frühere SPD-Arbeitsminister Franz Müntefering hat es auf den Punkt gebracht: „Weniger Kinder, später in den Beruf, früher raus, länger leben, länger Rente beziehen: Wenn man das nebeneinander legt, muss man kein Mathematiker sein, da reicht Volksschule Sauerland, um zu wissen: Das kann nicht gehen!“ Recht hat er, der Sauerländer Müntefering. Er wollte bildhaft klarmachen, dass ein späterer Rentenbeginn und Abstriche bei der Rentenhöhe unvermeidbar sind. Nahles und Merkel hätten wohl Volksschule Sauerland nicht geschafft. Aber für die Bundesregierung hat es allemal gereicht.
Um wachsende Altersarmut zu vermeiden, muss schnellstens eine Stärkung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge erfolgen. Das hat die Koalition zwar vor – aber mit den Mitteln, die schon in der Vergangenheit versagt haben, nämlich solchen, die auf Lebensversicherungen basieren. Die setzen fast nur auf Zinsanlagen und verzichten weitgehend auf Aktien. Ausgerechnet die langfristig ertragreichste Anlageform wird mit 4 % Anteil sträflich vernachlässigt.
Die heftig gescholtene Riester-Rente, die betrieblichen Pensionskassen und neue Lebensversicherungsverträge werfen deswegen lächerliche Renditen ab. Mit deutscher Gründlichkeit, mit Regulierungswut, teuren Garantieversprechen, Risikoscheu und Aktienfeindlichkeit ist das System der Altersvorsorge deshalb zur Zeitbombe geworden.
Schon in biblischen Zeiten gab es eine Regel, wie das Vermögen am besten aufzuteilen sei: Ein Drittel im Beutel, ein Drittel in Häusern, ein Drittel in Geschäften. Übersetzt heißt das: Ein Drittel in Festgeld und Festverzinslichen, ein Drittel in Immobilien und ein Drittel in Aktien. Die Deutschen dagegen sind in Geschäften – also Aktien mit 8 % Anteil am Gesamtvermögen – total unterinvestiert. Wollten sie bibeltreu anlegen, müssten sie den Aktienanteil vervierfachen. Das würde sich lohnen.
Aktien sind langfristig die mit Abstand ertragreichste Anlageform. Einschließlich wieder angelegten Dividenden betrugen die durchschnittlichen jährlichen Renditen in den 45 Jahren bis 2015 an den wichtigsten Börsen 10 bis 11 Prozent. Davon können die von Albträumen geplagten Zinssparer nur träumen.
Für die private und betriebliche Altersvorsorge ist deshalb ein viel höherer Aktienanteil unverzichtbar. Anstatt aber das Rad neu zu erfinden, würde ein Blick ins Ausland helfen, um bewährte Lösungen zu finden und zu übernehmen.
In der Schweiz können Einzahlungen in die „gebundene Vorsorge“ bis zu bestimmten Höchstbeträgen vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden, und die Kapitalzuwächse bei Aktien, Anleihen, Fonds, etc. sind in der Ansparphase steuerfrei. Der Maximalbetrag beläuft sich 2016 bei Personen ohne betriebliche Vorsorge auf 20% des Nettoeinkommens, maximal umgerechnet rund
31 000 Euro, bei Personen mit beruflicher Vorsorge – die in der Schweiz üblich ist – auf gut 6200 Euro. Nach der Auszahlung werden die Erträge zu vergünstigten Sätzen besteuert.
In Frankreich gibt es den Aktiensparplan PEA (Plans d’Epargne en Actions), in den Jeder bis zu 150 000 Euro in Aktien, Fonds und Zinsanlagen investieren kann. Voraussetzung: 75 % der Aktien sind von Unternehmen aus der EU. Die Erträge sind steuerfrei, ab fünf Jahren Haltedauer auch die Kursgewinne. 2014 hat die Regierung zusätzlich einen PEA für kleine und mittlere Unternehmen eingerichtet, in den weitere 75 000 Euro angespart werden können. Ein Ehepaar kann zusammen also bis zu 450 000 Euro in renditestarken Aktien und Fonds investieren. Im Vergleich dazu sind die Riester-Höchstbeträge ein Witz.
Die USA sind ein Musterbeispiel betrieblicher und privater Altersvorsorge.
Da dort die Beitragssätze zur Rentenversicherung mit 12,4 % um 6,3 Prozentpunkte niedriger sind als in Deutschland – und seit über 30 Jahren unverändert – haben Arbeitnehmer netto mehr von ihren Löhnen übrig, und Unternehmen müssen weniger einzahlen. Dieses „eingesparte“ Geld fließt seit 1978 vielfach in die betriebliche Vorsorge, die mit dem 401(k) Plan eine rentable und flexible Lösung bietet. Viele Arbeitgeber beteiligen sich mit 50 bis 100% an den Beiträgen. Die Arbeitnehmer können bis zu 18 000 Dollar (2016) jährlich einzahlen, über 60-jährige zusätzlich 6000 Dollar. Die Beiträge fließen überwiegend in Aktien- und gemischte Fonds, bei denen die Anlagestrategie auf das erwartete Rentenalter abgestimmt wird. Sie sind für Arbeitnehmer steuerfrei, der Arbeitgeber kann seinen Anteil als Betriebsausgaben absetzen. Zusätzlich gibt es den Roth-IRA, mit dem aus versteuertem Einkommen Vorsorgevermögen bis zu jährlich 5500 Dollar gebildet werden kann. Kapitalwachstum, Dividenden und Zinsen sind nach fünf Jahren steuerfrei.
Die unkomplizierte, flexible und renditestarke Art der Altersvorsorge bewirkt, dass US-Bürger kurz vor Renteneintritt im Durchschnitt 360 000 Dollar auf ihren Vorsorge-Konten angespart haben. Die Amerikaner besitzen laut dem Allianz Global Wealth Report über 202 000 Euro Durchschnittsvermögen, die Deutschen mit 68 000 Euro nur ein Drittel davon. Deutschland ist in der Industrie Weltklasse, bei Vermögensbildung und Altersvorsorge Provinzklasse. Das lässt sich leicht ändern.
Das Rad in der Altersvorsorge ist andernorts schon erfunden und läuft rund. Unsere überforderten Gesetzesgeber könnten es einfach kostenlos und zollfrei importieren.